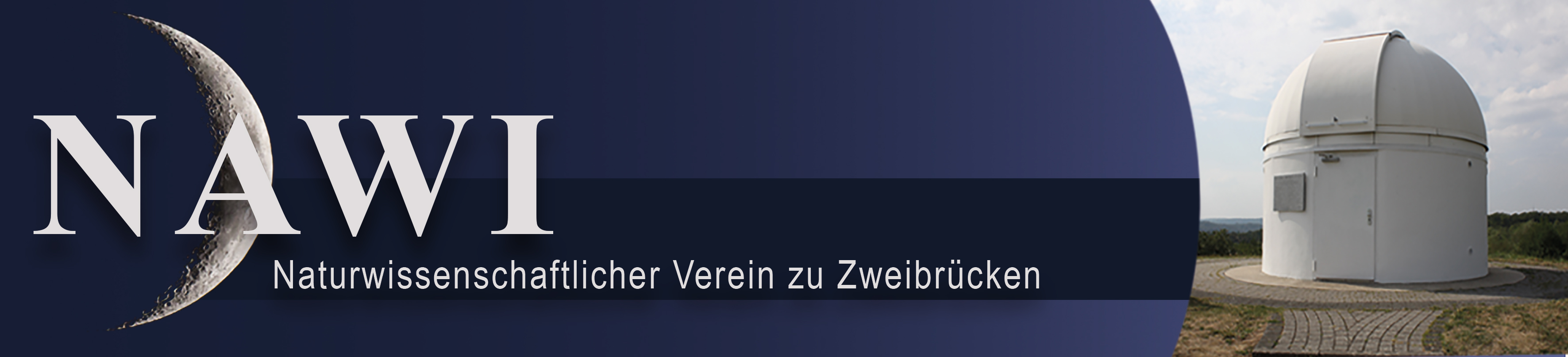Der Sternhimmel im März 2025
Aufgrund der immer später erfolgenden Sonnenuntergänge öffnet die Sternwarte Freitagabends im März erst ab 19 Uhr. Einen klaren Nachthimmel natürlich vorausgesetzt.
Sonne und Mond
Der März hält einige astronomische Besonderheiten für uns bereit, darunter eine in unseren Breiten partielle Mondfinsternis in den Morgenstunden des 14. März.
Der Eintritt in den Halbschatten erfolgt um 4:56 Uhr, ist jedoch aufgrund des geringen Helligkeitsunterschieds schwer zu beobachten. Deutlich besser sichtbar ist der Beginn der partiellen Phase um 6:09 Uhr – zu diesem Zeitpunkt steht der Mond allerdings nur noch knapp 6 Grad über dem Westhorizont. In Zweibrücken geht er bereits um 6:55 Uhr unter, während die totale Verfinsterung erst um 7:26 Uhr beginnen würde.
Animation vom Hügel der Sternwarte aus.
Erstellt mit Stellarium 23.3
Am Samstag, dem 29. März, findet eine partielle Sonnenfinsternis statt, die in ihrer gesamten Dauer sichtbar ist.
Aus diesem Anlass öffnet die Sternwarte bei klarem Himmel an diesem Tag bereits um 10 Uhr vormittags. In Zweibrücken beginnt die partielle Phase um 11:18 Uhr und endet um 12:59 Uhr.
Die folgende Animation des Ablaufs der Sonnenfinsternis wurde ebenfalls mit Stellarium 23.3 erstellt
Planeten
Merkur bietet trotz seines Perihels (größte Sonnennähe) am 4. März in der ersten Monatshälfte eine passable Sichtbarkeit am westlichen Abendhimmel.
Venus hat ihre beste Zeit als Abendstern hinter sich. Sie bleibt bis Mitte März sichtbar, mit lichtstarker Optik möglicherweise noch bis zum 20. des Monats. Gegen Monatsende taucht sie bereits am Morgenhimmel auf.
Mars verliert im Laufe des Monats deutlich an Helligkeit, steht aber weiterhin hoch am Abendhimmel. Im Fernrohr ist ein leichter Rückgang seiner Helligkeit durch die Phase der Sonnenbeleuchtung erkennbar – bis Monatsende schrumpft sie auf etwa 90 % relativ zu seiner Oppositionsstellung im Januar. Ähnlich wie der Mond zeigt auch der Mars Phasen, da wir ihn aus verschiedenen Blickwinkeln von der Erde aus beobachten. Allerdings sind diese Phasen beim Mars viel weniger ausgeprägt als beim Mond oder bei inneren Planeten wie Venus und Merkur.
Jupiter dominiert die erste Nachthälfte und bleibt ein auffälliger Begleiter am Sternenhimmel.
Saturn hält sich zusammen mit der Sonne am Taghimmel auf, er ist nicht mehr zu beobachten.
Uranus und Neptun spielen keine bedeutende Rolle mehr für Beobachtungen. Uranus verkürzt seine Abendsichtbarkeit erheblich, während Neptun sich am Taghimmel aufhält und unsichtbar bleibt.
Sternenhimmel
Die funkelnden Sterne des Winterhimmels haben sich nach Sonnenuntergang bereits weit nach Westen verschoben, bleiben aber noch markante Blickfänge am Nachthimmel. Gleichzeitig ist der Übergang zum Frühlingshimmel in vollem Gange.
Ein Blick nach Norden zeigt die zirkumpolaren, das ganze Jahr sichtbare Sternbilder. Hoch im Nordosten steht der Große Bär mit dem bekannten Sternbild des Großen Wagens. In seiner Nähe befindet sich der Kleine Bär mit dem Polarstern, um den sich das unscheinbare Sternbild Drache schlängelt. Im Nordwesten sind Cassiopeia und Kepheus zu sehen. Ganz knapp über dem Horizont kann von einer erhöhten Beobachtungsposition ein heller Stern beobachtbar sein: Deneb, der Hauptstern des Sommersternbildes Schwan.
Am Westhimmel lassen sich nach Sonnenuntergang noch einige Herbststernbilder erspähen, darunter Andromeda.
Im Süden dominiert das beeindruckende Wintersechseck mit seinen markanten Wintersternbildern: Zwillinge, Fuhrmann und Stier. Besonders auffällig im Stier ist der rötliche Aldebaran, das „Auge des Stiers“, der gelegentlich mit dem Mars verwechselt wird. Bei den Inuit heißt Aldebaran Nanurjuk und symbolisiert einen Eisbären, der von einer Gruppe von Hunden gestellt wurde – dargestellt durch die Hyaden, einen offenen Sternhaufen. Die Jäger, die den Eisbären erlegen wollen, sind in der Mythologie der Inuit die drei markanten Gürtelsterne des Orion sowie der helle Rigel. Auch in der griechischen Mythologie wird Orion als Himmelsjäger gesehen, gefolgt von den Sternbildern Großer und Kleiner Hund, letzterer mit Sirius, dem hellsten Stern am Nachthimmel. Das markanteste Objekt im Orion ist der bekannte Orionnebel, eine aktive Sternentstehungsregion. Einige seiner jungen Sterne, darunter die Trapezsterne, erreichen Oberflächentemperaturen von etwa 50.000 Kelvin.
Am Osthimmel steigt allmählich das Frühlingssternbild Löwe empor, in der zweiten Nachthälfte folgt die Jungfrau. Diese Sternbilder entfalten ihre volle Pracht jedoch erst im Frühjahr.
Die folgende Grafik zeigt die Himmelsansicht am 15. Marz um 22 Uhr.